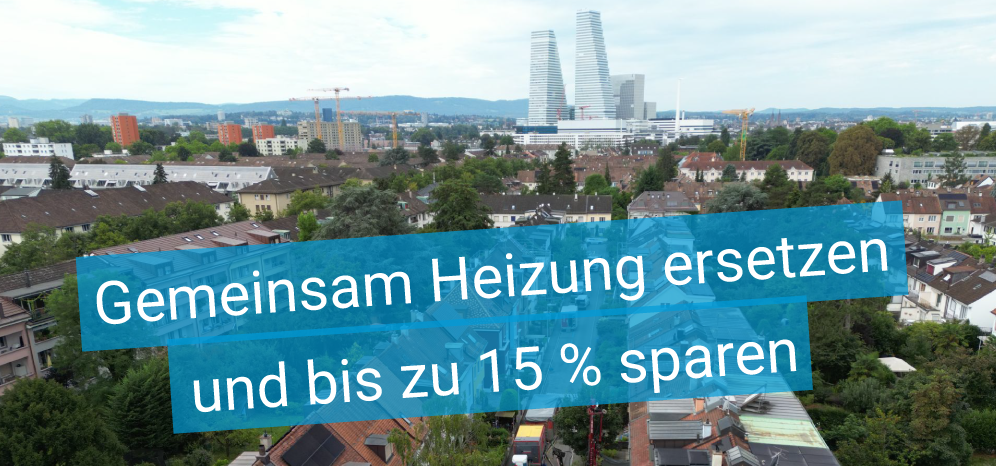Die Lebensdauer einer PV-Anlage ist ein entscheidender Faktor, wenn es um die Rentabilität und Umweltfreundlichkeit einer Investition in Solarenergie geht. Eine Photovoltaikanlage kann über Jahrzehnte Strom erzeugen – doch wie lange halten die verschiedenen Komponenten tatsächlich, und wie lässt sich die Nutzungsdauer verlängern? In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Haltbarkeit von Solaranlagen, die wichtigsten Einflussfaktoren und praktische Tipps, um das Beste aus Ihrer Anlage herauszuholen.
Die Lebensdauer einer PV-Anlage ist entscheidend für Rentabilität und Umweltfreundlichkeit. Eine Solaranlage kann Jahrzehnte Strom erzeugen. Wie lange halten Komponenten und wie verlängert man die Nutzungsdauer? Artikel zu Haltbarkeit, Einflussfaktoren und Tipps.
Zögern Sie auch nicht, sich bei Fragen direkt an unsere Experten von Solarmacher zu wenden. Wir beraten Sie ausführlich und unterstützen Sie vollumfänglich bei Ihrem Vorhaben, erneuerbare Energien direkt von Ihrem Dach zu beziehen.
Die PV-Anlage im Überblick – Komponenten und ihre Lebensdauer
Eine PV-Anlage besteht aus mehreren essenziellen Bauteilen, die je nach ihrer Funktion und Beanspruchung eine unterschiedliche Lebensdauer aufweisen. In der Regel setzen sich PV-Anlagen aus den PV-Modulen, dem Wechselrichter, einem Montagesystem (auch Unterkonstruktion genannt) sowie optional einem Stromspeicher zusammen.
PV-Module: Das Herzstück der Photovoltaikanlage
Die PV-Module sind das zentrale Element jeder Solaranlage und wesentlich für ihre Lebensdauer und Effizienz. Ihre Langlebigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Materialqualität, der Herstellungsprozess und Umwelteinflüsse. Im Durchschnitt halten PV-Module etwa 25 bis 30 Jahre, mit Herstellergarantien, die eine Leistung von 80–85 % nach dieser Zeit zusichern. Tatsächlich können gut gewartete Module sogar darüber hinaus Strom liefern – wenn auch mit etwas geringerer Leistung.
Leistungsgarantie und Degradation: Wie lange halten PV-Module von Solarmacher?
Die meisten Hersteller garantieren eine Leistungsfähigkeit von 80–85 % nach 25 Jahren. Dieser allmähliche Leistungsverlust nennt sich Degradation. Hochwertige Module, vor allem monokristalline, verlieren jährlich etwa zwischen 0,2 und 0,5 % ihrer Leistung, was bedeutet, dass sie nach 25 Jahren noch rund 85 % der Anfangsleistung bringen. Bei günstigen oder minderwertigen Modulen kann die jährliche Degradationsrate höher sein, was die Langlebigkeit erheblich beeinträchtigt.
Solarmacher arbeitet unter anderem mit renommierten Herstellern wie SunPower und Meyer Burger zusammen, die eine Leistungsgarantie von über 90 % nach 25 Jahren bieten und damit zur Premiumklasse zählen. Für Glas/Glas Module gibt Meyer Burger sogar eine Leistungsgarantie von 93,2 % nach 30 Jahren.
Faktoren, die die Lebensdauer beeinflussen
Modultyp und Materialqualität
- Monokristalline Module: Hergestellt aus hochreinem Einkristall-Silizium, zeichnen sich diese Module durch hohe Effizienz und geringe jährliche Degradation (ca. 0,3–0,5 %) aus. Sie sind besonders langlebig und ideal für langfristige Investitionen.
- Polykristalline Module: Diese bestehen aus weniger reinem Mehrkristall-Silizium, was die Herstellung günstiger macht. Die Module haben eine etwas höhere jährliche Degradationsrate von etwa 0,5–0,7 % und eine etwas kürzere Lebensdauer als monokristalline Module.
- Dünnschichtmodule: Dünnschichtmodule bestehen aus flexiblen Materialien wie Cadmiumtellurid und haben eine niedrigere Effizienz und Lebensdauer. Sie eignen sich eher für Spezialanwendungen und Standorte mit besonderen Anforderungen an Gewicht und Flexibilität.
Umgebungseinflüsse
- UV-Strahlung: Langjährige Sonneneinstrahlung kann die Module schädigen, insbesondere die Versiegelung und das Glas. Hochwertige Module sind UV-beständig und resistenter gegen Degradation.
- Temperaturschwankungen: Grosse Temperaturunterschiede führen zu thermischen Belastungen und können Mikrorisse in den Solarzellen verursachen. Monokristalline Module sind hier in der Regel beständiger.
- Schnee und Hagel: Module in schneereichen Regionen sollten hohe Traglasten aushalten. Hochwertige Module sind oft hagelresistent und bestehen intensive Witterungstests.
- Staub, Laub oder Vogelkot auf den Modulen mindern die Effizienz. Eine gelegentliche Reinigung und visuelle Kontrolle, vor allem in staubigen Regionen, unterstützt eine lange Lebensdauer.
- Potentialinduzierte Degradation (PID): Bei PID führen hohe Spannungsunterschiede zu einer Ionendrift innerhalb des Moduls, was vor allem bei warmen und feuchten Bedingungen Kurzschlüsse und Leistungsverluste verursacht. Moderne, PID-resistente Module sind speziell darauf ausgelegt, diesen Effekt zu minimieren.
- Elektromigration: Ähnlich wie PID verursacht Elektromigration über die Zeit Materialbewegungen innerhalb der Zellen, jedoch hauptsächlich unter sehr hoher elektrischer Belastung. Während PID häufiger auftritt, ist Elektromigration typischerweise ein Faktor in langlebigen Modulen mit extremem Dauerstress.
Wechselrichter: Die Lebensader der Anlage
Der Wechselrichter ist ein zentrales Element jeder PV-Anlage, da er den in den Modulen erzeugten Gleichstrom (DC) in netzkompatiblen Wechselstrom (AC) umwandelt. Ohne den Wechselrichter könnten die Module ihren Strom nicht in das Haushaltsnetz einspeisen oder für Elektrogeräte nutzbar machen. Allerdings hat der Wechselrichter eine kürzere Lebensdauer als die Solarmodule selbst: Im Durchschnitt hält ein Wechselrichter etwa 10 bis 15 Jahre, bevor ein Austausch erforderlich wird. Ein Wechselrichterwechsel ist also im Lebenszyklus einer PV-Anlage ein durchaus einzuplanender Kostenfaktor.
Warum halten Wechselrichter kürzer?
Wechselrichter sind technisch komplex und arbeiten kontinuierlich, um die Spannung und Frequenz anzupassen. Während PV-Module einfach Sonnenlicht einfangen, muss der Wechselrichter das Stromnetz „lesen“ und sich ständig an die variierenden Spannungs- und Frequenzanforderungen anpassen. Diese permanente Regelung erzeugt Hitze und erhöht den Verschleiss der Bauteile.
Typische Garantien und Kosten beim Wechselrichter-Austausch
Die meisten Wechselrichter-Hersteller bieten standardmässig Garantiezeiten von 5 bis 10 Jahren, die sich oft gegen Aufpreis auf bis zu 20 Jahre verlängern lassen. SMA und SolarEdge, mit denen Solarmacher zusammenarbeitet, bieten z.B. eine 12-jährige Basisgarantie, die bis auf 25 Jahre erweiterbar ist. Ein Austausch kann je nach Leistung und Modell zwischen 1’500 Franken und 3’000 Franken kosten. Ein frühzeitiges Erkennen von Verschleiss und eventuellen Defekten ist daher entscheidend.
Einflussfaktoren für die Lebensdauer eines Wechselrichters
Bestimmte Faktoren können die Lebensdauer eines Wechselrichters positiv oder negativ beeinflussen. Hier die wichtigsten:
- Temperatur und Belüftung: Wechselrichter erzeugen Wärme während des Betriebs, die sich negativ auf die Lebensdauer auswirken kann, wenn sie nicht richtig abgeführt wird. Eine gut belüftete Umgebung sowie eine Installation an einem schattigen Ort oder in kühleren Innenräumen (z. B. Keller) können die Abnutzung reduzieren und die Lebensdauer verlängern.
- Leistungsbeanspruchung: Wechselrichter, die regelmässig an ihrer maximalen Kapazität arbeiten, altern schneller. Anlagen mit hohen Stromspitzen oder dauerhaft hoher Belastung sollten daher einen ausreichend dimensionierten Wechselrichter haben, um unnötigen Verschleiss zu vermeiden. Ein überdimensionierter Wechselrichter kann in diesen Fällen sinnvoll sein.
- Qualität und Herstellergarantie: Hochwertige Wechselrichter, wie von Herstellern wie SMA oder SolarEdge, bieten nicht nur eine bessere Verarbeitung, sondern auch erweiterte Garantien. Die Investition in ein qualitativ höherwertiges Gerät kann sich lohnen, da sie oft eine längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit bieten.
- Wartung und Monitoring: Regelmässige Wartung und Überwachung des Wechselrichters sind entscheidend. Moderne Monitoring-Systeme ermöglichen es, den Zustand des Wechselrichters zu beobachten und frühzeitig auf eventuelle Abweichungen zu reagieren. Durch proaktive Wartung kann der Wechselrichter oft länger betriebsfähig bleiben und etwaige Reparaturen können rechtzeitig durchgeführt werden.
Montagesysteme: Die stabile Grundlage
Das Montagesystem respektive die Unterkonstruktion spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Effizienz der PV-Anlage und ist oft so konzipiert, dass es die gesamte Lebensdauer der Module von mindestens 30 Jahren überdauert. Dabei sind die Materialien – meist Aluminium oder verzinkter Stahl – korrosionsbeständig und langlebig, um extremen Witterungsbedingungen standzuhalten.
Garantien
Hersteller bieten in der Regel 10 bis 25 Jahre Garantie auf Montagesysteme, je nach Material und Anbieter. Diese Garantien decken meist strukturelle Stabilität und Korrosionsbeständigkeit ab und bieten somit langfristigen Schutz für eine zuverlässige Anlagenbasis.
Faktoren, die die Lebensdauer beeinflussen
- Materialqualität: Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, während verzinkter Stahl besonders robust ist und hohe Traglasten bewältigt. Beide Materialien gewährleisten eine lange Haltbarkeit, wobei spezieller Korrosionsschutz für Küsten- oder feuchte Regionen empfehlenswert ist.
- Witterungsbeständigkeit: Montagesysteme müssen Wind, Schnee und Hagel trotzen. In schneereichen Regionen ist ein System mit hoher Tragfähigkeit entscheidend. Regelmässige Überprüfungen bei ballastierten Flachdachsystemen stellen sicher, dass die Module stabil bleiben.
- Installation und Wartung: Eine fachgerechte Installation ist essenziell, um Stabilität zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. Regelmässige Sichtprüfungen – besonders bei Extremwetterlagen – verlängern die Lebensdauer zusätzlich.
Batteriespeicher: Flexible Nutzung und ihre Haltbarkeit
Ein Batteriespeicher erweitert das Potenzial einer PV-Anlage erheblich, indem er den Eigenverbrauch steigert und die Unabhängigkeit vom Stromnetz erhöht. Die Lebensdauer von Stromspeichern liegt jedoch meist deutlich unter der der PV-Module. Lithium-Ionen-Batterien – die heute am häufigsten verwendet werden – halten etwa 10 bis 15 Jahre und durchlaufen dabei mehrere tausend Ladezyklen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Batteriequalität, der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Da ein Batteriespeicher kein essenzieller Bestandteil einer Solaranlage ist, hat er allerdings auch keine Auswirkungen auf dessen Lebensdauer.
Garantien und Haltbarkeit
Die meisten Hersteller, mit denen Solarmacher zusammenarbeitet, wie z.B. LG Chem und SolarEdge, bieten auf Lithium-Ionen-Stromspeicher 10 Jahre Garantie und garantieren oft eine Restkapazität von etwa 60–80 % am Ende der Garantiezeit. Premium-Anbieter mit langlebigeren Batteriesystemen, wie solche auf Basis von Lithium-Eisenphosphat, bieten sogar bis zu 15 Jahre Garantie.
Ein gut gewarteter und passend dimensionierter Stromspeicher kann somit für viele Jahre zuverlässigen Strom liefern und die Abhängigkeit vom Netz erheblich verringern.
Ladezyklen und Ladetiefe: Warum „Volltanken“ die Batterie belastet
Je öfter und tiefer ein Speicher geladen und entladen wird, desto schneller altert er. Ideal ist eine regelmässige Nutzung, bei der der Speicher jedoch nie komplett entleert oder dauerhaft voll geladen wird. Aber warum ist das so?
Stellen Sie sich die Batterie wie einen grossen Parkplatz vor, auf dem die Ionen (die geladenen Teilchen) beim Laden und Entladen wie Autos „einparken“. Wenn der Speicher halb voll ist, finden die Ionen leicht einen Platz – das Laden verläuft schnell und ohne grossen Stress. Doch je voller der Speicher wird, desto enger wird der „Parkplatz“, und die Ionen haben Schwierigkeiten, einen freien Platz zu finden. Sie müssen sozusagen „weiter suchen“ und passen sich an die eng begrenzten Bereiche an. Das erzeugt Spannung und Stress für die Batterie und verkürzt langfristig ihre Lebensdauer.
Um diese Belastung zu minimieren, ist es ideal, die Batterie in einem Bereich von etwa 20 % bis 80 % zu halten. Hier bleibt der „Parkplatz“ entspannt und die Ionen finden leichter ihren Platz. Moderne Stromspeicher mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) übernehmen das für Sie: Sie sorgen dafür, dass die Batterie möglichst selten vollgeladen wird und in einem optimalen Bereich bleibt. So lässt sich die Batterie über Jahre hinweg effizient nutzen.
Weitere Einflussfaktoren auf die Lebensdauer von Stromspeichern
- Temperatur: Lithium-Ionen-Speicher arbeiten am besten bei konstanten Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad Celsius. Hohe Temperaturen beschleunigen chemische Reaktionen im Inneren und verringern die Kapazität schneller. Daher sollte der Speicher in einem gut belüfteten, kühlen Raum untergebracht werden, idealerweise mit geringer Luftfeuchtigkeit (20–40 %).
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren oder rund 5’000 Ladezyklen. Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) haben eine noch längere Lebensdauer und sind besonders temperaturstabil, was sie ideal für anspruchsvolle Einsatzbedingungen macht.
- Dimensionierung: Die richtige Grösse des Speichersystems ist entscheidend. Ein unterdimensionierter Speicher führt zu häufigeren Ladezyklen und verkürzt so die Lebensdauer. Ist der Speicher jedoch überdimensioniert, bleibt er oft teilgeladen, was ebenfalls die Kapazität beeinträchtigt. Eine gute Abstimmung mit der PV-Leistung und dem Haushaltsverbrauch ist daher unerlässlich. Solarmacher unterstützt Sie natürlich dabei. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein ausführliches Beratungsgespräch.
Rendite und Lebensdauer – Was bedeutet die Haltbarkeit für die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage?
Die Haltbarkeit und Lebensdauer einer PV-Anlage spielen eine zentrale Rolle bei der Berechnung ihrer Wirtschaftlichkeit. Eine lange Lebensdauer sorgt dafür, dass die anfängliche Investition auf Jahrzehnte gestreckt wird, wodurch die Stromproduktion immer kostengünstiger wird. Für eine rentable Anlage ist es daher entscheidend, dass sie lange und zuverlässig Strom liefert. Hier ist eine detaillierte Analyse der Faktoren, die die Rendite und Wirtschaftlichkeit beeinflussen:
Amortisationszeit und Rendite
Die Amortisationszeit einer PV-Anlage in der Schweiz beträgt durchschnittlich 10 bis 15 Jahre. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Anlage, „Gewinn“ zu generieren, da der erzeugte Strom kaum noch zu weiteren Kosten führt und die Anlage weiterhin Strom produziert. Dabei spielen die folgenden Aspekte eine entscheidende Rolle:
- Effizienz und Degradation der Module: Die jährliche Leistungsabnahme hochwertiger PV-Module beträgt oft nur 0,3–0,5 %. Das bedeutet, dass die Module auch nach 25 Jahren noch über 85 % ihrer ursprünglichen Leistung erbringen können, was die Wirtschaftlichkeit langfristig positiv beeinflusst.
- Eigenverbrauch und Einspeisung: Ein hoher Eigenverbrauchsanteil sorgt für mehr Einsparungen, da jede selbst genutzte Kilowattstunde günstiger ist als Netzstrom. Der Eigenverbrauch kann durch einen Speicher optimiert werden, sodass weniger Strom ins Netz eingespeist und zu niedrigen Tarifen verkauft werden muss.
Steigende Strompreise und Inflationsschutz
Die Strompreise in der Schweiz sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen und haben 2024 einen neuen Höchstwert erreicht. Der Medianpreis liegt nun bei über 30 Rappen./kWh – ein trauriger neuer Rekord. Allein im Kanton Zürich stieg der durchschnittliche Strompreis im Vergleich zu 2023 um über 40 %.
Angesichts dieser Entwicklung wird es immer wichtiger, sich vor weiteren Preissteigerungen abzusichern. Eine PV-Anlage bietet genau diesen Vorteil: Sie erzeugt über Jahrzehnte Strom zu fixen, einmaligen Investitionskosten, während Netzstrom den Schwankungen des Energiemarkts unterliegt.
Steuerliche Vorteile und Förderungen
Die Schweiz bietet attraktive Steuervergünstigungen und Förderungen für PV-Anlagen, die ebenfalls zur Wirtschaftlichkeit beitragen:
- Einmalvergütungen (EIV): Der Bund fördert mit dem Förderprogramm Pronovo PV-Anlage. Bei der Einmalvergütung handelt es sich um eine einmalige Investitionshilfe für Kleinanlagen bis 30 kWp. Dieses Programm löst das alte Modell der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV ab und fördert damit den Eigenverbrauch. Ab dem 01.04.2025 gelten folgende Tarife: 360.- CHF pro kWp installierte Leistung.
- Steuerliche Absetzbarkeit: In vielen Kantonen können die Investitionskosten für eine PV-Anlage bei der Einkommenssteuer abgesetzt werden. Besonders interessant für private Eigentümer ist, dass Eigenverbrauchsanteile oft steuerfrei sind, was die laufenden Einsparungen erhöht.
Betriebskosten und „Wahre Kosten“ einer Solaranlage
Zusätzlich zu den Anschaffungskosten entstehen bei PV-Anlagen jährliche Betriebskosten. Diese umfassen Wartung und Reinigung, Zählergebühren, Versicherungen und gelegentliche Reparaturen, wie etwa den Austausch des Wechselrichters alle 10 bis 15 Jahre. Eine realistische Kostenplanung, die ca. 1–2 % der Investitionskosten pro Jahr für laufende Ausgaben vorsieht, ist sinnvoll und erhöht die Transparenz der Gesamtkosten (Total Cost of Ownership).
Szenarien für die Zukunft und technologische Entwicklungen
Die PV-Technologie hat enorme Fortschritte gemacht und zeigt bereits heute ihre Langlebigkeit. Ein Beispiel dafür ist die älteste PV-Anlage der Schweiz, die SUPSI-Anlage, die nach 40 Jahren noch 80 % ihrer ursprünglichen Leistung erreicht. Einige Module werden sogar erneut auf einem Neubau in Mendrisio installiert, und ähnliche ReUse-Projekte sind in Winterthur und Dübendorf aktiv. Solche Beispiele unterstreichen, wie wertbeständig PV-Anlagen sein können.
Wichtige Entwicklungen für die Zukunft
- Effizientere Module: Heute erreichen moderne Module nur noch eine jährliche Degradation von 0,3–0,5 %, was auf lange Sicht hohe Leistung sichert. Neue Technologien wie Heterojunction- oder bifaziale Module steigern die Effizienz weiter und nutzen auch indirektes Licht.
- ReUse und Lebensverlängerung: Die Möglichkeit, PV-Module nach Jahrzehnten wiederzuverwenden, zeigt das Potenzial für eine noch längere Lebensdauer und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
- Fortschritte bei Speichern und Steuerung: Verbesserte Batterien und intelligente Monitoring-Systeme machen den Einsatz von Solarstrom flexibler und effizienter, sodass mehr Eigenverbrauch möglich ist und die Unabhängigkeit wächst.
Diese Entwicklungen legen nahe, dass heutige PV-Anlagen weit über die geplanten 25 bis 30 Jahre hinaus wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden können und eine noch wertvollere Investition für die Zukunft darstellen.
Beispielrechnungen: PV-Anlage vs. Kein PV-System
Hier sind drei Vergleichsrechnungen, die auf den aktuellen Strompreisen basieren. Wir nehmen dabei eine PV-Anlage mit einer Leistung von 10 kWp an, die für einen Haushalt ca. 10.000 kWh pro Jahr produziert und davon 40 % direkt genutzt werden (Szenario 2). Ein zusätzlicher Stromspeicher erhöht den Eigenverbrauchsanteil in Szenario 3. Die Strompreise stiegen 2024 in der Schweiz auf einen Median von über 30 Rappen/kWh und werden aufgrund der Energiekrise sehr wahrscheinlich weiter ansteigen. Preiserhöhungen sind in unseren Berechnungen nicht berücksichtigt.
Szenario 1: Haushalt ohne PV-Anlage
Jährlicher Stromverbrauch: 10’000 kWh
Strompreis 2024: 0,30 Franken/kWh
Berechnung:
- 10’000 kWh x 0,30 Franken = 3’000 Franken pro Jahr für Netzstromkosten
Wenn die Strompreise in den nächsten 10 Jahren nicht steigen, zahlt dieser Haushalt in 10 Jahren etwa 30’000 Franken für Strom. Ohne PV-Anlage sind Sie vollständig abhängig von der Strompreisinflation.
Szenario 2: PV-Anlage (ohne Speicher)
Anlage: 10 kWp PV-System, ca. 40 % Eigenverbrauchsanteil
Brutto-Investitionskosten: 30’000 Franken
Staatliche Einmalvergütung (EIV): 10kWp à 360 Franken = 3’600 Franken
Netto-Investitionskosten vor Steuereffekt: 26’400 Franken
Steuerabzug: 20% der Netto-Investitionen von 26’400 Franken = 5’280 Franken
Netto-Investitionskosten nach Steuereffekt: 21’120 Franken
Stromkostenersparnis pro Jahr:
- Eigenverbrauch (40 % von 10’000 kWh): 4’000 kWh
- Stromkostenersparnis bei Eigenverbrauch: 4’000 kWh x 0,30 CHF = 1’200 Franken pro Jahr
Die restlichen 6.000 kWh werden ins Netz eingespeist. Bei einer Einspeisevergütung von etwa 0,15 Franken/kWh (Die durchschnittliche Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen im Jahr 2024 liegt zwischen 12 und 20 Rappen pro kWh) ergibt dies eine jährliche Vergütung von 900 Franken.
Dazu kommen laufende Kosten von ca. 1–2 % der Brutto-Investitionssumme. Der Einfachheitshalber rechnen wir mal mit 2 % = 600 Franken pro Jahr.
Gesamtersparnis pro Jahr: 1’200 Franken + 900 Franken – 600 Franken = 1’500 Franken
Amortisationszeit: 21’120 Franken (Investition) / 1’500 Franken (jährliche Ersparnis) = 14 Jahre
Nach der Amortisation der Anlage spart der Haushalt pro Jahr etwa 1’500 Franken und bleibt weitgehend unabhängig von Strompreiserhöhungen. In 20 Jahren ergibt sich so eine Gesamtersparnis von 30’000 Franken.
Wichtig: Diese Rechnung berücksichtigt weder sich verändernde Energiepreise noch Anpassungen von Einspeisevergütungen. Mit jeder Strompreiserhöhung verringert sich die Amortisationszeit.
Szenario 3: PV-Anlage (mit Speicher)
Anlage: 10 kWp PV-System mit 10-kWh-Speicher
Eigenverbrauchsanteil mit Speicher: ca. 75 %
Gesamtkosten für Anlage und Speicher: 40’000 Franken
Einmalvergütung (EIV): 3’600 Franken
Netto-Investitionskosten vor Steuereffekt: 36’400 Franken
Steuerabzug: 20% der Netto-Investitionen von 36’400 Franken = 7’280 Franken
Netto-Investitionskosten nach Steuereffekt: 29’120 Franken
Stromkostenersparnis pro Jahr:
- Eigenverbrauch (75 % von 10’000 kWh): 7’500 kWh
- Stromkostenersparnis bei Eigenverbrauch: 7’500 kWh x 0,30 Franken = 2’250 CHF pro Jahr
Die restlichen 2’500 kWh werden für etwa 0,15 Franken/kWh eingespeist, was eine jährliche Einspeisevergütung von 375 Franken ergibt.
Dazu kommen laufende Kosten von ca. 1–2 % der Brutto-Investitionssumme. Der Einfachheitshalber rechnen wir mal mit 2 % = 800 Franken pro Jahr.
Gesamtersparnis pro Jahr: 2’250 Franken + 375 Franken – 800 Franken = 1’825 Franken
Amortisationszeit: 29’120 Franken (Investition) / 1’825 Franken (jährliche Ersparnis) = 16 Jahre
Nach der Amortisationszeit spart der Haushalt ca. 1’825 Franken jährlich. In 20 Jahren ergibt sich so eine Gesamtersparnis von 36’500 Franken. Durch den Speicher kann der Haushalt einen Grossteil des selbst produzierten Stroms nutzen und sich unabhängig von künftigen Strompreissteigerungen machen, die in unseren Berechnungen nicht berücksichtigt sind.
Zusammenfassung – Deshalb lohnt sich eine PV-Anlage
- Ohne PV-Anlage zahlt der Haushalt jährlich ca. 3’000 Franken für Strom und bleibt abhängig von steigenden Energiepreisen und Strompreisexplosionen.
- Mit PV-Anlage ohne Speicher amortisiert sich die Investition in etwa 14 Jahren und spart langfristig ca. 1’500 Franken pro Jahr bei gleichbleibenden Strompreisen.
- Mit PV-Anlage und Speicher erreicht der Haushalt eine noch höhere Autarkie und spart ca. 1’825 Franken jährlich, was die Investition in 16 Jahren amortisiert und vor Strompreisschwankungen schützt. Mit jeder Strompreisexplosion verringert sich auch die Amortisationszeit.
Diese Beispielrechnungen zeigen deutlich, wie die lange Lebensdauer und der hohe Eigenverbrauch einer PV-Anlage die Wirtschaftlichkeit verbessern und langfristig Kostenvorteile bieten.
Die Rechnungsbeispiele zeigen auch, dass sowohl die Amortisationszeit als auch die Einsparungen v.a. von den erwarteten Energiepreisen abhängig sind. Eine verlässliche Aussage kann daher nicht gemacht werden.
Tipps für eine lange Lebensdauer der PV-Anlage
Hier ist eine umfassende Checkliste, damit Ihre PV-Anlage viele Jahrzehnte zuverlässig arbeitet und Ihnen maximalen Ertrag liefert:
- Zusammenarbeit mit Solarmacher: Eine gute PV-Anlage beginnt mit der richtigen Planung. Solarmacher sorgt dafür, dass die Ausrichtung und Neigung der Module perfekt auf das Dach und die Sonneneinstrahlung abgestimmt sind. Auch die Wahl der passenden Module und Hersteller wird individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. Durch sorgfältige Standortanalyse, richtige Dimensionierung der Anlage und Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten wird sichergestellt, dass Ihre PV-Anlage langfristig maximale Leistung und Stabilität bietet. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein ausführliches Beratungsgespräch.
- Hochwertige Komponenten wählen: Achten Sie auf langlebige Module und hochwertige Wechselrichter, am besten mit langen Garantien. Wir beraten Sie gerne zu den besten Produkten.
- Regelmässige Wartung: Alle ein bis zwei Jahre sollten alle Komponenten kontrolliert werden. Solarmacher bietet Monitoring-Verträge an, um dies zuverlässig sicherzustellen.
- Module sauber halten: In schmutzanfälligen Gebieten empfiehlt sich eine regelmässige Reinigung. Verschmutzungen können die Leistung um bis zu 30 % senken.
- Monitoring-Systeme nutzen: Digitale Überwachung erkennt Leistungsverluste frühzeitig und zeigt, wenn Wartung oder Reinigung nötig ist.
- Stromspeicher optimal einsetzen: Ein Speicher sollte nicht ständig vollgeladen oder komplett entladen werden, um die Lebensdauer zu maximieren.
- Temperatur im Blick behalten: Installieren Sie Wechselrichter und Speicher an kühlen, gut belüfteten Orten, um Überhitzung zu vermeiden.
- Korrosionsbeständige Montagesysteme: Besonders in feuchten oder salzhaltigen Gebieten ist dies wichtig, um Rostbildung zu vermeiden.
- Prüfung nach extremem Wetter: Kontrollieren Sie die Module nach Hagel, Sturm oder starkem Schneefall auf Beschädigungen.
- Schattierungen vermeiden: Pflanzen oder Gebäudeteile, die Schatten werfen, regelmässig entfernen oder anpassen.
Mit diesen Tipps und der richtigen Unterstützung durch Solarmacher können Sie sicherstellen, dass Ihre PV-Anlage über viele Jahre hinweg stabil und effizient Strom liefert.
Fazit – Wie Sie die Lebensdauer Ihrer PV-Anlage maximieren können
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lebensdauer einer PV-Anlage stark von der Qualität der Komponenten, der Wartung und den Umgebungsbedingungen abhängt. Durch die richtige Wahl hochwertiger Module und Wechselrichter, regelmässige Wartung und die Anpassung an Standortbedingungen können Betreiber die Lebensdauer ihrer Anlage verlängern und die Wirtschaftlichkeit maximieren. Solarmacher unterstützt Sie dabei, das volle Potenzial Ihrer PV-Anlage auszuschöpfen und Ihre Anlage optimal zu betreiben.

.svg)
.svg)