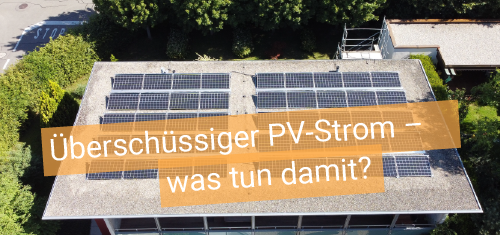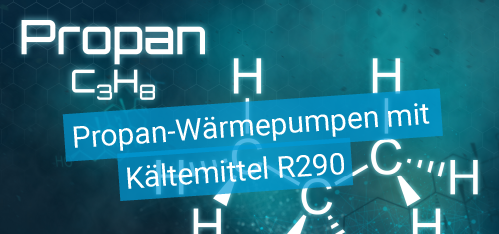Am 28. September 2025 hat die Schweiz einen historischen Entscheid gefällt: Der Eigenmietwert auf selbstgenutztem Wohneigentum wird abgeschafft. Für Eigentümer:innen bedeutet das nicht nur eine Entlastung beim steuerbaren Einkommen, sondern auch den Wegfall wichtiger Abzugsmöglichkeiten. Gerade Investitionen in eine neue Heizung oder eine Photovoltaikanlage sind davon direkt betroffen.
In diesem Beitrag erfahren Sie, was die Reform konkret vorsieht, welche steuerlichen Chancen heute noch bestehen – und warum es sich lohnt, Ihre Sanierungs- und Energieprojekte rechtzeitig zu planen.
Was genau wurde beschlossen?
Mit der Volksabstimmung vom 28. September 2025 wurde der Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung angenommen. Künftig entfällt die Besteuerung des fiktiven Eigenmietwerts auf selbstgenutzten Eigenheimen. Im Gegenzug werden auf Stufe Bundessteuer zentrale Abzugsmöglichkeiten gestrichen: Weder Schuldzinsen noch werterhaltende Liegenschaftskosten können künftig geltend gemacht werden.
Besonders relevant für Eigenheimbesitzer:innen ist auch der Umgang mit Investitionen in erneuerbare Energien und Effizienzsteigerungen. Während auf Bundesebene klar ist, dass der Abzug entfällt, können die Kantone bis längstens 2050 entscheiden, ob sie Aufwendungen für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen – etwa den Ersatz einer Ölheizung durch eine Wärmepumpe oder die Installation einer Photovoltaikanlage – weiterhin steuerlich berücksichtigen wollen oder nicht.
Ein Beispiel zeigt die konkrete Auswirkung: Wer CHF 50’000 in eine neue Wärmepumpe oder PV-Anlage investiert und dafür CHF 10’000 Förderbeiträge erhält, trägt eine Nettoinvestition von CHF 40’000.
Abhängig vom steuerbaren Einkommen und ob es sich um eine alleinstehende Person oder ein Ehepaar handelt, sehen die Einsparungen wie folgt aus:
Für Alleinstehende
Für Ehepaare (gemeinsame Veranlagung)
Heute ergibt dies bei der direkten Bundessteuer eine Steuerersparnis von rund CHF 1’600 bis CHF 4'800 – je nach Einkommenslage. Mit der Reform entfällt diese Möglichkeit – die Investition lohnt sich also vor Inkrafttreten steuerlich noch stärker.
Ab wann gilt die Abschaffung – und was gilt bis dahin?
Die Volksabstimmung war der Startschuss – nicht das Zielband. Damit der Systemwechsel greift, braucht es zuerst das Umsetzungsrecht auf Bundesebene und anschliessend kantonale Anpassungen. Bis ein offizielles Inkraftsetzungsdatum feststeht, gelten die heutigen Regeln (Eigenmietwert und Abzüge) unverändert weiter. Praktisch heisst das, dass sich ein rechtzeitiges Planen (Heizungsersatz oder Installation PV, Förderanträge, Finanzierung) auszahlt. Auch wenn die rechtliche Umstellung gestaffelt erfolgt, so wollen Sanierungsvorhaben dennoch sauber geplant sein.
1. Geplanter Zeitrahmen
Obwohl der Entscheid gefallen ist, liegt der Inkraftsetzungstermin noch in der Zukunft. Mit der Umsetzung ist nicht vor 2028 zu rechnen, weil Bundes- und Kantonsrecht (Verordnungen, kantonale Gesetzesanpassungen) erst noch aufeinander abgestimmt werden müssen. Der Bundesrat setzt das Datum fest; die Kantone regeln die Übergänge.
2. Übergangsphase: Bestehende Regeln gelten weiter
Bis zur formellen Inkraftsetzung bleibt alles beim Alten: Eigenmietwert, Abzugsmöglichkeiten und heutige Steuerbedingungen gelten weiter. Das gibt Planungssicherheit. Sinnvoll ist es dennoch, Projekte rechtzeitig vorzubereiten, solange die aktuelle Abzugsfähigkeit besteht. Zu bedenken gilt es auch Vorlaufzeiten für Planung, Installation und behördliche Schritte wie Bau- und Fördergeldgesuche. Auch eine erhöhte Nachfrage von Eigenheimbesitzern ist nicht auszuschliessen, was wiederum Auswirkungen auf die Auslastung des installierenden Gewerbes hat. Handeln Sie nicht überstürzt – aber frühzeitig.
Steuerliche Änderungen für selbstgenutzte Liegenschaften
Mit dem Inkrafttreten entfällt die Eigenmietwertbesteuerung auf der Hauptwohnung; im Gegenzug werden Abzüge neu geregelt – insbesondere der künftig quotal-restriktive Schuldzinsenabzug (d. h. Schuldzinsen sind nur noch anteilig abziehbar, und zwar im Verhältnis des vermieteten zum gesamten unbeweglichen Vermögen; Beispiel: 20 % Vermietungsanteil = max. 20 % der Zinsen abziehbar; bei reiner Selbstnutzung i. d. R. kein Abzug) und der Wegfall der Bundesabzüge für energetische Massnahmen (kantonale Lösungen möglich). Für Zweitliegenschaften können Kantone zudem eine Objektsteuer vorsehen. Solange kein Inkraftsetzungstermin verfügt ist, gilt auch hier die heutige Praxis unverändert.
1. Wegfall des Eigenmietwerts
Mit Inkrafttreten wird der Eigenmietwert auf der selbstgenutzten Hauptwohnung als fiktives Einkommen nicht mehr besteuert. Für viele Eigentümer:innen bedeutet das eine spürbare Entlastung beim steuerbaren Einkommen, weil der bisher angerechnete Wohnvorteil entfällt. Gleichzeitig ist wichtig: Bis zur offiziellen Inkraftsetzung bleibt das heutige System bestehen – Sie deklarieren den Eigenmietwert weiterhin wie gewohnt.
Praktisch heisst das: Wer heute plant (z. B. Heizung ersetzen, PV installieren), rechnet vorerst noch mit dem aktuellen Recht. Nach der Reform verschiebt sich die Steuerlogik: Es gibt kein fiktives Mietertragselement mehr auf der Hauptwohnung – dafür greifen an anderer Stelle neue Grenzen (z. B. beim Zinsabzug). Für Zweit- und Renditeobjekte gelten weiterhin separate Regelungen (siehe weiter unten).
2. Schuldzinsen / Zinsabzug wird neu geregelt
Der Zinsabzug wird quotal-restriktiv: Schuldzinsen sind nur noch in dem Anteil abziehbar, in dem Ihr unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet ist. Wer ausschliesslich selbst in der Liegenschaft wohnt, kann Zinsen grundsätzlich nicht mehr wie heute abziehen.
Beispiel zur Einordnung: Bei 20 % Vermietungsanteil wäre höchstens 20 % der jährlich bezahlten Zinsen steuerlich abziehbar; bei 0 % Vermietung entfällt der Abzug.
Für den Übergang sind Sonderregelungen vorgesehen, namentlich ein Ersterwerberabzug (zeitlich befristet und betragsmässig begrenzt), um den erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum nicht abrupt zu erschweren. Die Details (Höhe, Dauer, Bedingungen) werden in den Ausführungsbestimmungen festgelegt. Konsequenz für die Finanzplanung: Der Fokus verlagert sich von „Zinsen abziehen“ hin zu Amortisation, Zinsstrategie (Saron vs. Fest) und Liquiditätsreserven.
3. Zweitliegenschaften / Ferienwohnungen
Kantone können künftig eine Objekt- bzw. Liegenschaftssteuer auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften erheben. Ob, in welcher Höhe und nach welcher Bemessungsgrundlage eine solche Steuer eingeführt wird (z. B. Steuerwert, Katasterwert, fixe Pauschale, Freibeträge), obliegt der Entscheidung der jeweiligen Kantone. Damit ist keine automatische Mehrbelastung verbunden – es handelt sich um eine Option, deren Ausgestaltung kantonal erfolgt.
Für Eigentümer:innen heisst das: Je nach Standort der Ferienwohnung können künftig unterschiedliche Regelungen gelten. Es lohnt sich, kantonale Informationen und allfällige Übergangsfristen zu verfolgen. Bestehende Abgaben (z. B. Kurtaxen) bleiben davon unberührt; die Objektsteuer wäre – falls eingeführt – zusätzlich und separat geregelt.
4. Werterhaltende Liegenschaftskosten fallen weg
Bis heute konnten Eigentümer:innen viele laufende Unterhaltsarbeiten steuerlich abziehen – zum Beispiel Reparaturen oder den Ersatz einzelner Haustechnik-Komponenten. Diese Regelung senkte die Steuerlast und machte kleinere Instandhaltungen finanziell etwas leichter.
Mit der beschlossenen Reform entfällt diese Möglichkeit nach aktuellem Stand vollständig. Unterhalts- und werterhaltende Kosten können künftig weder bei der direkten Bundessteuer noch bei den kantonalen Steuern abgezogen werden. Solche Ausgaben sind also in Zukunft vollständig von den Eigenheimbesitzer:innen zu tragen.
Im steuerlichen Fokus bleiben einzig Investitionen mit Energiespar- oder Umweltschutzcharakter. Dazu zählen insbesondere der Ersatz einer alten Heizung durch eine Wärmepumpe oder die Installation einer Photovoltaikanlage. Ob und in welchem Umfang die Kantone solche Investitionen steuerlich weiterhin berücksichtigen, ist derzeit noch offen – möglich bleibt dies aber höchstens bis 2050.
5. Abzug für energetische Massnahmen
Abzüge für energetische Massnahmen (z. B. Dämmung, Fensterersatz, Heizungssanierung inkl. Rückbau) sollen bei der direkten Bundessteuer nach der Reform wegfallen; die Kantone erhalten jedoch bis längstens 2050 die Möglichkeit, eigene Abzugsmodelle vorzusehen. Das bedeutet: Während auf Bundesebene künftig kein solcher Abzug mehr vorgesehen ist, kann Ihr Kanton gewisse energetische Investitionen weiterhin (befristet oder konditioniert) berücksichtigen – die genaue Ausprägung wird auf kantonaler Ebene geregelt.
Für die Praxis heute gilt: Solange die Reform nicht in Kraft ist, bleibt die aktuelle Abzugsfähigkeit bestehen, teilweise mit der Option, hohe Aufwendungen über mehrere Jahre zu verteilen. Förderprogramme (z. B. Pronovo, Gebäudeprogramm, kantonale Fördergelder) bestehen unabhängig von der Steuerreform und können die Nettoinvestition spürbar reduzieren – sie bleiben damit ein zentrales Element der Investitionsplanung, auch nach dem Systemwechsel.
- Heizungsersatz (z. B. Wärmepumpe) – heute und in Zukunft
Solange die Reform noch nicht gilt, sind energiesparende/umweltschonende Investitionen (inkl. Rückbau) bei der direkten Bundessteuer grundsätzlich abziehbar. In vielen Fällen ist eine Verteilung über bis zu drei Steuerperioden möglich, wenn der Betrag das Einkommen übersteigt. Nach der Reform entfällt dieser Abzug auf Bundesebene; kantonale Lösungen bleiben möglich.
Praxisbeispiel (heute, illustrative Zahlen):
Bruttokosten Heizung inkl. Rückbau: CHF 50’000, abzüglich Förderbeiträge: CHF 10’000 → Nettoinvestition CHF 40’000 (förderrechtlich üblich: netto abziehbar).
Übersteigt die Nettoinvestition Ihr Einkommen, kann sie auf bis zu drei Perioden verteilt werden (je nach geltenden Regeln).
- Photovoltaikanlagen (PV)
Für Photovoltaikanlagen bleibt die Förderung auch nach der Steuerreform ein zentraler Bestandteil der Investition. Über Pronovo können Eigenheimbesitzer:innen weiterhin Einmalvergütungen beantragen, die je nach Grösse und Art der Anlage mehrere tausend Franken ausmachen können. Diese Beiträge reduzieren die Anfangsinvestition spürbar und machen den Bau einer PV-Anlage finanziell attraktiv.
Beim Thema Steuern gilt: Auf Stufe Bundessteuer entfällt nach der Reform die Möglichkeit, eine PV-Anlage als Abzug geltend zu machen. Damit verändert sich die Rechnung im Vergleich zu heute. Ob und in welchem Umfang die Kantone den Abzug für PV-Anlagen weiterhin zulassen, ist derzeit noch offen. Sie haben bis längstens 2050 die Möglichkeit, solche steuerlichen Vorteile anzubieten.
Für Hausbesitzer:innen bedeutet das: Die finanzielle Unterstützung für Photovoltaik besteht auch in Zukunft in erster Linie über Förderprogramme. Steuerlich lohnt sich eine Investition besonders dann, wenn sie noch vor Inkrafttreten der Reform erfolgt und somit die aktuellen Abzugsmöglichkeiten auf Bundesebene genutzt werden können.
Bundessteuer: So ermitteln Sie Ihre Ersparnis korrekt
Wir verzichten der Übersichtlichkeit halber bewusst auf kantonale Zahlen und zeigen die Mechanik ausschliesslich für die direkte Bundessteuer (DBST).
Schritt-für-Schritt:
- Bestimmen Sie Ihr steuerbares Einkommen (nach Abzügen).
- Öffnen Sie die DBST-Tariftabellen / Rechner der ESTV (Tarif A/B je nach Situation):
- Grenzsteuersatz (Bund) via Δ-Methode: (neue Steuer – aktuelle Steuer) / (neues zu versteuerndes Einkommen – altes zu versteuerndes Einkommen).
- Steuerersparnis (Bund) heute ≈ Nettoinvestition × Grenzsteuersatz (Bund).
- Nach Inkrafttreten entfällt dieser Abzug auf Bundesebene (für selbstgenutzte Liegenschaften).
Beispiel:
Profil: ledig, konfessionslos, steuerbares Einkommen CHF 120’000. DBST-Grenzsteuersatz (Beispiel): 6 %(bitte Ihren exakten Wert mit der DBST-Tariftabelle bestimmen; der maximale Bundestarif liegt bei 11,5 %). Nettoinvestition: CHF 30’000 → Bundessteuer-Ersparnis heute ≈ CHF 1’800. Nach Reform: CHF 0 (kein Bundesabzug bei Selbstnutzung).
Checkliste: Jetzt sinnvoll anpacken
- Projekte vorbereiten: Heizungsersatz (z. B. Wärmepumpe) & PV planen, Offerten einholen.
- Förderfenster nutzen: Pronovo / Das Gebäudeprogramm prüfen; Antrag vor Projektstart stellen.
- Bundessteuer-Ersparnis berechnen: DBST-Tariftabelle öffnen → Grenzsteuersatz (Bund) via Δ-Methode → Nettoinvestition × Grenzsteuersatz.

.svg)
.svg)