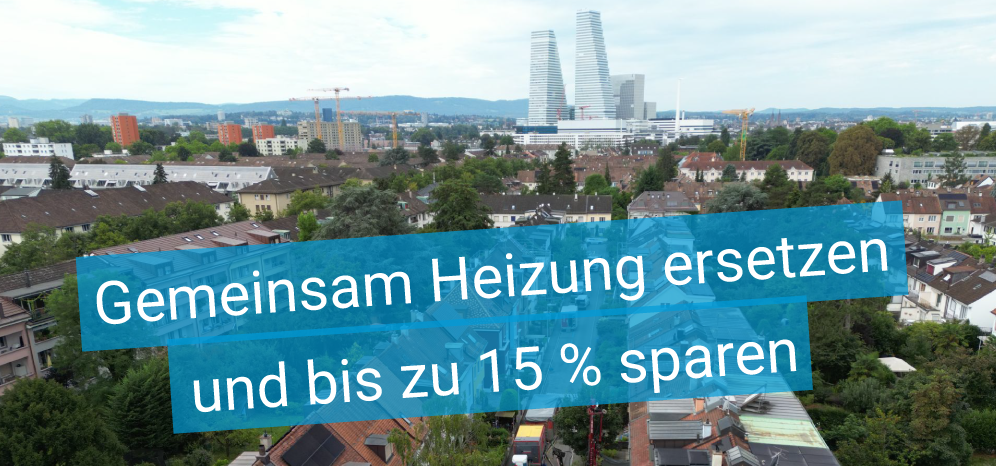Das Klima- und Innovationsgesetz (KlG) der Schweiz, offiziell “Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit”, das am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null zu reduzieren. Das Gesetz entstand als indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative und wurde in einer Volksabstimmung im Juni 2023 mit 59,1 % der Stimmen angenommen.
Dabei legt das Klimaschutzgesetz die langfristigen Klimaziele der Schweiz fest. Es unterstützt den Übergang von fossilen zu klimafreundlichen Heizsystemen und fördert Investitionen in klimafreundliche Technologien, z.B. Wärmepumpen. Die Vorlage enthält keine neuen Steuern, Gebühren oder Abgaben. Es gibt darin auch keine neuen Vorschriften oder Verbote.
Parallel dazu wurde auch das CO₂-Gesetz revidiert, um die Emissionsreduktionen bis 2030 zu konkretisieren. Das Gesetz, das zeitgleich mit dem KIG am 1. Januar in Kraft trat, sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 zu halbieren. Beide Gesetze ergänzen sich: Während das KlG die langfristigen Ziele bis 2050 definiert, legt das revidierte CO₂-Gesetz die notwendigen Massnahmen für die erste Etappe bis 2030 fest. Zusammen bilden sie den Rahmen für die zukünftige Klimapolitik im Alpenland.
Wir empfehlen: Auch wenn das neue Gesetz keine neuen Vorschriften oder Verbote enthält, lohnt sich der Umstieg auf umweltfreundliche und nachhaltige Heizlösungen. Es winken bis zu 30’000 Franken Fördergelder, wenn Sie heute auf eine Wärmepumpe umsteigen. Kontaktieren Sie uns noch heute und wir beraten Sie ausführlich.
Ziele des Klimaschutzgesetzes
- Netto-Null-Emissionen bis 2050:
- Die Schweiz verpflichtet sich, ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Netto-Null zu senken. Dies bedeutet, dass alle Emissionen maximal reduziert und verbleibende Emissionen durch Negativemissionstechnologien ausgeglichen werden müssen (Art. 3 Abs. 1 KIG).
- Zwischenziele für Emissionsreduktionen:
- Gegenüber 1990 müssen die Emissionen bis 2040 um mindestens 75 % und im Zeitraum 2041–2050 durchschnittlich um mindestens 89 % gesenkt werden (Art. 3 Abs. 3).
- Richtwerte für spezifische Sektoren:
- Gebäude: bis 2040 um 82 %, bis 2050 um 100 %
- Verkehr: bis 2040 um 57 %, bis 2050 um 100 %
- Industrie: bis 2040 um 50 %, bis 2050 um 90 % (Art. 4 Abs. 1 KIG).
Wesentliche Massnahmen des Klimaschutzgesetzes
Das Klimaschutzgesetz setzt gezielte Fördermassnahmen ein, um die Energiewende in der Schweiz voranzutreiben. Dabei stehen insbesondere klimafreundliche Heizsysteme, die Unterstützung innovativer Unternehmen sowie die Anpassung an den Klimawandel im Fokus. Die Fördermassnahmen sind klar strukturiert und zeitlich befristet, um einen Anreiz für frühzeitige Investitionen zu schaffen.
Förderprogramm für klimafreundliche Heizsysteme
Ziel: Das KlG unterstützt den Ersatz fossiler Heizungen durch klimafreundliche Alternativen wie Wärmepumpen, Holzheizungen und andere erneuerbare Systeme.
Förderhöhe: Jährlich werden 200 Millionen Franken über einen Zeitraum von zehn Jahren bereitgestellt (also insgesamt 2 Milliarden Franken). Diese Mittel ergänzen bestehende Programme wie das Gebäudeprogramm des Bundes und der Kantone.
Wer profitiert?
- Mehrfamilienhäuser stehen im Fokus: Die Fördermittel sind primär für den Ersatz ineffizienter Elektroheizungen und Öl-/Gasheizungen in Mehrfamilienhäusern vorgesehen.
- Privatpersonen mit Einfamilienhäusern profitieren weiterhin durch die bestehenden Fördergelder in Höhe von bis zu 30’000 Franken, vor allem auf kantonaler Ebene, aber auch die schweizweite Förderung myclimate. Das Beste daran: Wenn Sie Ihre Wärmepumpe durch Heizungsmacher installieren lassen, kümmern wir uns um die Beschaffung der Fördergelder. Sie müssen sich dahingehend um nichts kümmern. Kontaktieren Sie uns gerne noch heute und wir beraten Sie ausführlich.
- Immobilienkonzerne und institutionelle Investoren können ebenfalls profitieren, allerdings mit der Auflage, dass die Fördermittel zweckgebunden verwendet werden müssen und ein nachhaltiger Betrieb der Gebäude gewährleistet sein muss.
Hintergrund und gesetzliche Verankerung: Die Förderung klimafreundlicher Heizsysteme mit 200 Millionen Franken pro Jahr ist in Artikel 50a des Energiegesetzes festgelegt, der im Rahmen des KIG hinzugefügt wurde. Die Mittel werden über die Kantone verteilt, wobei ein Sockelbeitrag pro Einwohnerin und Einwohner vorgesehen ist. Die genauen Anforderungen an die förderfähigen Heizsysteme regelt der Bundesrat.
Unterstützung für Unternehmen: Förderung klimafreundlicher Technologien
Ziel: Schweizer Unternehmen sollen finanziell unterstützt werden, wenn sie innovative, emissionsarme Technologien entwickeln oder bestehende Prozesse klimafreundlicher gestalten.
Förderhöhe: Bis 2030 stehen jährlich bis zu 200 Millionen Franken zur Verfügung, also insgesamt 1,2 Milliarden Franken.
Welche Unternehmen profitieren?
- Industrieunternehmen mit hohem Energieverbrauch: Besonders energieintensive Betriebe, etwa in der Stahl- oder Zementproduktion, erhalten Anreize zur Umstellung auf emissionsärmere Verfahren.
- Innovative Start-ups und Technologieunternehmen: Unternehmen, die an der Entwicklung von CO₂-absorbierenden Technologien oder alternativen Energieträgern arbeiten, können gezielt Fördermittel beantragen.
- KMU mit Dekarbonisierungsplänen: Auch kleinere Unternehmen können profitieren, wenn sie einen klaren Netto-Null-Fahrplan erarbeiten. Dieser muss konkrete Massnahmen zur CO₂-Reduktion enthalten (Artikel 5 KlG).
Auflagen: Unternehmen müssen bis 2050 Netto-Null-Emissionen aufweisen (Art. 5, Abs. 1). Dazu können diese Fahrpläne erstellen, die alle direkten und indirekten Emissionen bilanzieren und Massnahmen enthalten, um Emissionen zu reduzieren oder auszugleichen (Art. 5, Abs. 2 KIG, Art. 3 KlV, Klimaschutzverordnung). Branchen können kollektive Fahrpläne erstellen, welche spezifische Lösungen und Massnahmen für ihre Branche vorsehen (Art. 4 KlV). Die Fahrpläne müssen mindestens alle fünf Jahre aktualisiert werden (Art. 7 Abs. 2 KlV).
Unternehmen, die dies tun, erhalten bis 2030 Finanzhilfen für neuartige Technologien und Verfahren zur Erreichung der Netto-Null-Ziele. Hierfür wird ein sechsjähriger Verpflichtungskredit bereitgestellt (Art. 6 KIG). Finanzhilfen werden bis maximal 50 % der anrechenbaren Investitions- oder Betriebskosten vergeben (Art. 14 KlV).
Anpassung an den Klimawandel: Netzwerk für Klimaanpassung
Ziel: Neben der Emissionsreduktion sieht das KlG auch Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vor. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse, steigender Temperaturen und schmelzender Gletscher sollen Bund, Kantone, Gemeinden, Wirtschaft und Wissenschaft enger zusammenarbeiten.
Wichtige Massnahmen:
- Einrichtung eines nationalen Netzwerks „Anpassung an den Klimawandel“ aus Vertretern von Bund, Kantonen, Gemeinden, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, das den Austausch von Strategien und Forschungsergebnissen fördert (Art. 29 KlV).
- Förderung klimafreundlicher Stadtplanung, z. B. durch mehr Grünflächen in Städten zur Reduktion der Hitzebelastung.
- Hochwasserschutz und Lawinenprävention durch verstärkten Ausbau von Schutzmassnahmen in gefährdeten Regionen.
Gesetzliche Grundlage: Diese Massnahmen sind in Artikel 8 KlG verankert, der Bund und Kantone verpflichtet, entsprechende Schutzmassnahmen zu ergreifen.
Freiwillige Klimatests für die Finanzbranche
Die Finanzbranche soll durch freiwillige Klimatests dazu beitragen, Investitionen in emissionsarme Technologien und klimafreundliche Projekte zu lenken. Der Test erfolgt mindestens alle zwei Jahre (Art. 30 KlV). Während diese Massnahme für Banken und Versicherungen freiwillig ist, soll sie langfristig dazu beitragen, Finanzflüsse nachhaltiger auszurichten. Der Bund selbst kann mit der Finanzbranche entsprechende Vereinbarungen treffen (Art. 9 KIG).
Weitere Massnahmen
- Absicherung von Risiken: Der Bund sichert Risiken von Investitionen in notwendige öffentliche Infrastrukturbauten ab, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen (Art. 7 KIG). Finanzhilfen sichern Risiken bei Investitionen in thermische Netze (mind. 1000 MWh/Jahr und 0,5 MW Leistung) und Langzeitspeicher ab (Art. 21 KIV & Art. 22 KlV). Die Risikoabsicherung beträgt maximal 50 % der anrechenbaren Kosten, höchstens aber 5 Millionen Franken, bei einer Laufzeit von maximal 15 Jahren (Art. 25 KlV).
- Vorbildfunktion öffentlicher Verwaltungen: Die zentrale Bundesverwaltung verpflichtet sich, bereits bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Kantone und bundesnahe Betriebe sollen diesem Ziel ebenfalls ab 2040 folgen (Art. 10 KIG).
Hintergrund des Klimaschutzgesetzes
Die Schweiz hat sich über Jahrzehnte hinweg aktiv mit dem Klimawandel auseinandergesetzt und verschiedene gesetzgeberische Schritte unternommen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Kein Wunder, denn Studien zeigen, dass gerade im Alpenland die Temperatur schneller ansteigt als im weltweiten Durchschnitt.
Ausgangslage
Seit den 1980er Jahren ist der Klimawandel ein Thema in der schweizerischen Politik. Bereits 1986 wurde im Parlament auf die steigende CO₂-Konzentration in der Atmosphäre hingewiesen und vor möglichen Klimakatastrophen gewarnt. In den folgenden Jahrzehnten engagierte sich die Schweiz international, beispielsweise durch die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls im Jahr 2003 und des Pariser Klimaabkommens im Jahr 2017. National wurde im Jahr 2000 das CO₂-Gesetz eingeführt, das den Rahmen für die Reduktion von Treibhausgasemissionen setzte. Dieses Gesetz wurde mehrfach revidiert, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Zum 1. Januar, zusammen mit dem Klimaschutz, trat die neueste Version in Kraft.
Entstehungsgeschichte des Klima- und Innovationsgesetzes
Im Jahr 2019 wurde die Volksinitiative "Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative)" lanciert. Diese forderte, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral wird und keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr in den Verkehr bringt. Der Bundesrat teilte grundsätzlich das Ziel der Initiative, hielt jedoch ein generelles Verbot fossiler Energieträger für zu einschneidend. Daher wurde ein indirekter Gegenentwurf erarbeitet, der die Klimaneutralität bis 2050 anstrebt, jedoch auf Verbote verzichtet und stattdessen auf Förderprogramme und Innovation setzt. Die Initianten zogen ihre Initiative bedingt zurück, woraufhin der Gegenentwurf am 18. Juni 2023 zur Volksabstimmung kam und mit 59,07 % Ja-Stimmen angenommen wurde.
Relation zum CO₂-Gesetz
Das CO₂-Gesetz bildet seit 2000 die Grundlage der schweizerischen Klimapolitik und wurde mehrfach revidiert, zuletzt 2020. Allerdings wurde die Totalrevision des CO₂-Gesetzes in einer Volksabstimmung am 13. Juni 2021 knapp abgelehnt. Das Klima- und Innovationsgesetz ergänzt das bestehende CO₂-Gesetz, indem es langfristige Klimaziele festlegt und Förderprogramme für den Übergang zu erneuerbaren Energien vorsieht. Während das CO₂-Gesetz spezifische Massnahmen zur Emissionsreduktion regelt, bietet das KlG einen übergeordneten Rahmen für die Klimapolitik der Schweiz.
Klimaschutzgesetz 2025 – Warum jetzt der beste Zeitpunkt für den Umstieg ist
Das neue Klimaschutzgesetz bietet attraktive Förderungen und setzt ambitionierte Ziele für eine nachhaltige Zukunft in der Schweiz. Es enthält keine Verbote, sondern starke finanzielle Anreize, etwa beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme wie Wärmepumpen. Mit klaren Zwischenzielen und einer langfristigen Strategie stellt das KlG sicher, dass Schweizer Haushalte und Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt werden. Nutzen Sie die Gelegenheit und investieren Sie jetzt in eine nachhaltige Zukunft – die beste Zeit dafür ist jetzt. Kontaktieren Sie uns jederzeit für eine persönliche und ausführliche Beratung.

.svg)
.svg)