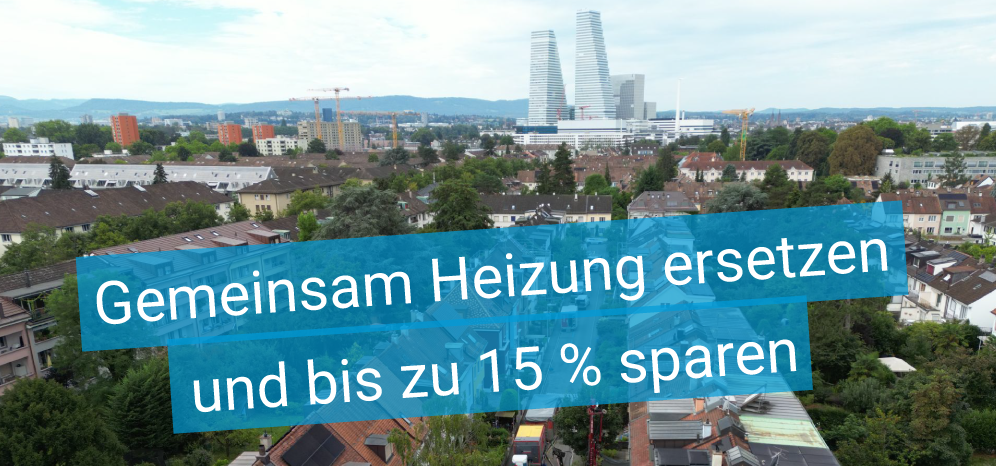Wenn Ihre Photovoltaikanlage mehr Strom produziert, als Sie aktuell verbrauchen, stellt sich zwangsläufig eine entscheidende Frage: Wohin mit dem Überschuss?
Ob Sie ihn ins Netz einspeisen, selbst verbrauchen – etwa über einen Speicher oder in Kombination mit einer Wärmepumpe – oder gezielt vermarkten, hängt von verschiedenen Faktoren ab: von Ihrer technischen Infrastruktur, den geltenden Vergütungssätzen und nicht zuletzt von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich derzeit spürbar verändern.
In diesem Artikel zeigen wir von Solarmacher Ihnen, welche Optionen es gibt und wie Sie Ihren Solarstrom nicht nur effizient, sondern auch finanziell und ökologisch sinnvoll nutzen können. Und falls Sie noch keine eigene Anlage besitzen: Bei Solarmacher erhalten Sie unverbindlich ein passendes Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Kontaktieren Sie uns noch heute.
Einspeisen in der Schweiz: Was ist möglich?
Wenn Ihre Solaranlage mehr Strom produziert, als Sie selbst verbrauchen können, wird dieser Überschuss ins öffentliche Stromnetz eingespeist und Sie erhalten dafür eine Vergütung. Doch wie hoch diese ausfällt, variiert stark.
Keine nationale Einspeisevergütung sondern Rückliefertarife vom lokalen Netzbetreiber
Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es in der Schweiz keine einheitlich geregelte Einspeisevergütung. Stattdessen legt jeder Verteilnetzbetreiber (VNB) eigene Rückliefertarife fest. Diese setzen sich in der Regel aus zwei Komponenten zusammen:
- dem Arbeitspreis für die Rücklieferung (zwischen ca. 6 und 14 Rp./kWh, je nach Region)
- einer möglichen Vergütung für Herkunftsnachweise (HKN) bei Strom aus erneuerbaren Quellen (aktuell meist zwischen 1–4 Rp./kWh)
Die genauen Tarife können Sie auf den Websites Ihres Netzbetreibers oder im Tarifvergleich der ElCom einsehen.
Netzanschluss und Abrechnung: Was Sie beachten müssen
Damit Ihre Einspeisung funktioniert:
- Muss Ihre Anlage beim Netzbetreiber gemeldet und registriert sein
- Erfolgt die Abrechnung meist automatisch über den Smart Meter
- Die Gutschrift erfolgt monatlich, quartalsweise oder jährlich – je nach Netzbetreiber
Ab 2026: Dynamische Netztarife durch neues Stromversorgungsgesetz
Mit dem revidierten Stromversorgungsgesetz (StromVG) tritt am 1. Januar 2026 eine wichtige Neuerung in Kraft: Die Netzbetreiber werden verpflichtet, dynamische Netznutzungstarife anzubieten.
Das bedeutet:
- Die Netznutzungskosten orientieren sich an Tageszeit, Netzbelastung oder saisonalen Schwankungen
- Wer Strom einspeist oder bezieht, kann künftig gezielt auf günstige oder besonders nachhaltige Zeiten reagieren
- Voraussetzung ist meist ein intelligentes Messsystem (Smart Meter), das ohnehin flächendeckend eingeführt wird
Ziel dieser Reform ist es, Eigenverbrauch und Netzstabilität zu fördern und die Lasten gerechter zu verteilen. Für Sie als Anlagenbetreiber bedeutet das: Mehr Spielraum, aber auch mehr Verantwortung, um den Einspeisezeitpunkt möglichst sinnvoll zu wählen.
Eigenverbrauch und Speicherlösungen: Das Beste aus dem eigenen Strom holen
Der direkte Eigenverbrauch Ihres selbst produzierten Solarstroms ist meist die wirtschaftlich sinnvollste Option, insbesondere angesichts der vergleichsweise niedrigen Rückliefertarife. Denn: Jeder selbst genutzte Kilowattstunde Strom sparen Sie sich zum vollen Marktpreis (aktuell oft 20–30 Rp./kWh), während eingespeister Strom nur mit wenigen Rappen vergütet wird.
Warum Eigenverbrauch sich lohnt
- Höhere Ersparnis: Je mehr Sie selbst verbrauchen, desto weniger Strom müssen Sie teuer aus dem Netz beziehen
- Unabhängigkeit vom Strompreis: Besonders attraktiv bei steigenden Energiepreisen
- Nachhaltiger Konsum: Sie nutzen den Strom dann, wenn er produziert wird – CO₂-frei und lokal
Speicher als Schlüssel zur Eigenverbrauchsoptimierung
Mit einem Batteriespeicher lässt sich der Eigenverbrauch deutlich steigern – typischerweise von 30–35 % auf bis zu 70–80 %, je nach Systemgrösse und Verbrauchsverhalten. Denn ein Speicher ermöglicht es Ihnen, tagsüber produzierten Solarstrom abends oder nachts zu nutzen.
Weitere Vorteile:
- Netzunabhängigkeit bei Stromausfall (optional mit Notstromfunktion)
- Lastspitzenmanagement in Kombination mit Wärmepumpe oder E-Mobilität
Mehr Flexibilität mit Blick auf dynamische Stromtarife (ab 2026 relevant)
Eigenverbrauch clever kombinieren
Besonders effektiv wird Eigenverbrauch, wenn Sie mehrere Komponenten intelligent miteinander vernetzen:
- Photovoltaikanlage + Speicher + Wärmepumpe: Eigenverbrauch für Heizung und Warmwasser
- Photovoltaikanlage + Wallbox: Strom fürs eigene E-Auto
Smart-Home-Lösungen: Optimieren den Stromverbrauch zeitlich und bedarfsgerecht
Direktvermarktung: Strom verkaufen statt einspeisen?
Neben dem klassischen Eigenverbrauch und der Rückspeisung ins Netz gibt es in der Schweiz seit einigen Jahren weitere Möglichkeiten, selbst produzierten Solarstrom gezielt mit anderen zu teilen oder direkt zu verkaufen, auch bekannt als Direktvermarktung.
Gemeint ist hier nicht die Teilnahme an der Strombörse, sondern neue gesetzlich geregelte Modelle wie ZEV, vZEV und bald LEG, die es ermöglichen, überschüssigen Solarstrom innerhalb eines Zusammenschlusses oder sogar im Quartier zu nutzen. Auf den ersten Blick attraktiv, auf den zweiten häufig komplex und mit hohen Anforderungen verbunden.
ZEV – Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
- Bereits seit 2018 erlaubt
- Mehrere Parteien (z. B. in einem Mehrfamilienhaus oder Areal) nutzen gemeinsam eine PV-Anlage
- Der Strom wird physisch direkt vor Ort verteilt, ohne Nutzung des öffentlichen Netzes
- Vorteil: Keine Netznutzungsgebühren, keine Abgaben
- Abrechnung erfolgt intern, oft über ein spezielles ZEV-Mess- und Abrechnungssystem
Einschränkung: Nur möglich, wenn alle Parteien am selben Netzanschlusspunkt hängen und örtlich verbunden sind. Ideal also für Neubauten oder Gebäude mit einheitlichem Eigentümer.
vZEV – Virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (seit 2025 erlaubt)
- Neu eingeführt per 1. Januar 2025
- Mehrere Liegenschaften oder Einfamilienhäuser können sich virtuell zusammenschliessen, also ohne physische Verbindung
- Voraussetzung:
- Alle Teilnehmer befinden sich auf der gleichen Netzebene (bis 1 kV)
- Es kommen intelligente Messsysteme (Smart Meter) zum Einsatz
- Der Solarstrom wird buchhalterisch aufgeteilt, je nach produziertem und verbrauchtem Strom
- Netz wird dabei nicht physisch umgangen, aber Netznutzungskosten können reduziert werden
Vorteile:
- Mehr Flexibilität als klassischer ZEV
- Nutzung über Grundstücksgrenzen hinweg
- Einstieg in kollektive Energieprojekte auch für kleinere Anlagenbetreiber
Aber:
- Erfordert technisches Setup, detaillierte Verträge und klare Rollenverteilung
- Abrechnung komplexer, vZEV-Verantwortliche haften für korrekte Abwicklung
LEG – Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (ab 2026 erlaubt)
- Ab 1. Januar 2026 treten mit dem neuen Stromversorgungsgesetz weitere Neuerungen in Kraft
- LEG ermöglicht es, lokal erzeugten Strom über das öffentliche Netz an andere Teilnehmer in der Gemeinde oder im Quartier zu liefern
- Auch hier: Voraussetzung ist der Einsatz von Smart Metern und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Ziel: lokale, dezentrale Energieversorgung fördern und Netzbelastung reduzieren
Vorteile:
- Erweiterung des Wirkungsbereichs über einzelne Gebäude hinau
- Potenzial für gemeinsame Nutzung von Solarstrom, Speicherlösungen, E-Ladestationen etc.
- Reduzierte Netznutzungsentgelte (teilweise bis zu 40 %)
Aber auch hier gilt: Komplexität steigt – sowohl technisch als auch organisatorisch. Es braucht klare Abmachungen, Verrechnungsmodelle und ein zuverlässiges Monitoring.
Warum Direktvermarktung (noch) keine Lösung für alle ist
Auch wenn vZEV und LEG neue Möglichkeiten eröffnen, bleiben viele Herausforderungen:
- Hoher Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand (Organisation, Abrechnung, Verträge)
- Technische Infrastruktur nötig (Smart Meter, zentrale Steuerungssysteme)
- Wirtschaftlichkeit abhängig von Teilnehmerzahl, Verbrauchsprofil und Standort
Zudem bleibt trotz Direktvermarktung oft ein Stromüberschuss übrig, besonders tagsüber, wenn die meisten Teilnehmer nicht zu Hause sind. Dieser Überschuss wird dann trotzdem nur mit den üblichen Rückliefertarifen vergütet.
Strom verkaufen oder selbst nutzen? Diese Rechnung überzeugt
Wer eine Photovoltaikanlage betreibt, kann überschüssigen Strom ins Netz einspeisen und erhält dafür eine Einspeisevergütung – aktuell meist zwischen 6 und 14 Rappen pro Kilowattstunde. Doch lohnt es sich wirklich, den Solarstrom zu verkaufen?
Auf den ersten Blick wirkt das attraktiv, schliesslich fliesst eine kleine Vergütung aufs Konto. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich: Eigenverbrauch ist fast immer lukrativer als Einspeisung. Besonders dann, wenn Sie Ihren Eigenverbrauch mit einem Stromspeicher gezielt steigern.
Rechenbeispiel: Einspeisen vs. Eigenverbrauch mit Stromspeicher
Um zu zeigen, wie gross der Unterschied tatsächlich ist, vergleichen wir zwei Szenarien über 15 Jahre:
Annahmen:
- Jahresverbrauch: 4'500 kWh
- Strompreis: 30 Rappen/kWh
- Einspeisevergütung: 7 Rappen/kWh
- Stromspeicher: 9.7 kWh nutzbar
Eigenverbrauch: 30 % ohne Speicher, 80 % mit Speicher
Amortisation des Speichers: Pro Jahr spart man netto Stromkosten von CHF 517.50 ein. Sprich die Anschaffung des Speichers von rund 5’300 Franken ist nach ca. 10 Jahren amortisiert. Bei einer erwarteten Lebensdauer des Batteriespeichers von rund 15 Jahren, produzieren Sie während 5 Jahren gratis Strom.
Ergebnis: Wer einspeist, zahlt langfristig drauf. Mit Stromspeicher sparen Sie (konservativ gerechnet) – und das trotz Investition.
Warum Einspeisen langfristig weniger bringt
- Die Einspeisevergütung bleibt niedrig (gesetzlich ab 2026 mind. 6 Rp./kWh)
- Strompreise sind deutlich höher und steigen weiter – 2024 im Schnitt um 18 %
- Jeder selbst verbrauchte kWh spart 3–4-mal so viel wie ein eingespeister kWh bringt
Wer heute Solarstrom verkauft, bekommt wenig, muss aber bei Bedarf teuer zurückkaufen. Das lohnt sich nur bei sehr grossen Anlagen oder wenn keine Eigenverbrauchsoptimierung möglich ist.
Stromspeicher: Die clevere Alternative zur Einspeisung
Mit einem Stromspeicher erhöhen Sie Ihre Eigenverbrauchsquote auf 80 % oder mehr. Je nach Verbrauchsprofil, z. B. mit Wärmepumpe, E-Auto oder smarten Haushaltsgeräten, sind sogar bis zu 90 % möglich. Dadurch sinkt Ihr Netzstrombezug massiv und Sie machen sich unabhängig vom Strommarkt.
Zusätzliche Vorteile:
- Langfristiger Spareffekt: Speicher halten oft 20 Jahre und mehr
- Förderungen verfügbar: z. B. bis zu CHF 2'000.– in Thurgau oder Schaffhausen
Mehr Versorgungssicherheit – auch bei steigenden Preisen oder Stromausfällen
Unser Tipp: Strom verkaufen lohnt sich nur begrenzt – Speicher fast immer
Wer heute mit einer Solaranlage Geld sparen möchte, sollte nicht auf möglichst hohe Einspeisung setzen, sondern auf maximalen Eigenveerbrauch. Und der gelingt am besten mit einem passend dimensionierten Stromspeicher.
Lassen Sie sich von Solarmacher unverbindlich beraten. Wir zeigen Ihnen, wie viel Sie mit einer eigenen Anlage und einem Speicher wirklich sparen können.
Bonus: Die perfekte Ergänzung: Wärmepumpe, PV-Anlage und Speicher im Zusammenspiel
Wenn Sie über eine Solaranlage nachdenken oder bereits eine besitzen, lohnt sich der Blick auf eine weitere Technologie, die ideal dazu passt: die Wärmepumpe.
Denn: Eine Wärmepumpe nutzt elektrische Energie, um Ihr Haus effizient mit Wärme zu versorgen, und je mehr davon aus Ihrer eigenen PV-Anlage stammt, desto besser für Ihr Portemonnaie und die Umwelt.
Warum Wärmepumpe und PV-Anlage so gut zusammenpassen
- Wärmepumpen benötigen Strom. Dieser lässt sich ideal aus eigener Produktion nutzen.
- Tagsüber produziert Ihre Solaranlage Energie – genau dann, wenn auch die Wärmepumpe aktiv sein kann.
- Mit einem Batteriespeicher steht der Strom auch nachts oder an bewölkten Tagen zur Verfügung.
Ergebnis: hoher Autarkiegrad und geringere Abhängigkeit von Energieversorgern
Klimaschutz trifft Wirtschaftlichkeit
In Kombination mit Photovoltaik und Speicher kann Ihre Wärmepumpe weitgehend CO₂-frei betrieben werden und das bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Heizkosten im Vergleich zu Öl oder Gas.
Ein durchdachtes System schafft:
- Autarkiegrade von 70–90 % bei Strom und Wärme
- Langfristige Versorgungssicherheit, auch bei Energiekrisen oder steigenden Preisen
- Kombinierte Einsparung bei Strom- und Heizkosten
- Einen echten Beitrag zum Klimaschutz, direkt bei Ihnen zu Hause
Mit Smart-Home-Steuerungen lässt sich die Wärmepumpe so programmieren, dass sie bevorzugt dann läuft, wenn Strom aus der PV-Anlage verfügbar ist.
Unser Tipp: Zukunftssicher heizen – mit Solarstrom
Wer heute in eine neue Heizung investiert, sollte die Kombination mit Photovoltaik und Speicher unbedingt mitdenken. Denn: Die Wärmepumpe ist nicht nur eine moderne und effiziente Heizlösung, sondern auch der Schlüssel zu einer ganzheitlichen, nachhaltigen und kostensparenden Energieversorgung.
Solarmacher berät Sie gerne. Gemeinsam mit unseren Partnern finden wir die passende Lösung für Ihr Zuhause: Von der PV-Anlage über den Stromspeicher bis zur Wärmepumpe.
Einspeisen, verkaufen oder speichern – Ihr Strom, Ihre Entscheidung
Solarstrom zu verkaufen klingt im ersten Moment attraktiv, schliesslich fliesst eine Vergütung. Doch die Realität zeigt: Wer den eigenen Strom einspeist, verschenkt oft bares Geld. Denn die Einspeisevergütung ist und bleibt niedrig, während Strompreise weiter steigen.
Die deutlich smartere Lösung: Den eigenen Solarstrom selbst nutzen. Mit einem Stromspeicher steigern Sie Ihren Eigenverbrauch spürbar und damit auch Ihre Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit und langfristige Ersparnis. Kombiniert mit einer Wärmepumpe wird daraus ein echtes Energiesystem der Zukunft – effizient, klimafreundlich und wirtschaftlich.
Ganz gleich, ob Sie gerade eine Anlage planen oder Ihre bestehende erweitern möchten: Solarmacher unterstützt Sie dabei, die für Sie beste Lösung zu finden – kompetent, transparent und individuell.

.svg)
.svg)